Home › Foren › Austausch (öffentlich) › Register zu Gesundheitsdaten von Menschen mit psychischen Erkrankungen
- Dieses Thema hat 38 Antworten sowie 9 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 1 Monat, 2 Wochen von
 Pia aktualisiert.
Pia aktualisiert.
-
AutorBeiträge
-
21/09/2025 um 11:33 Uhr #416167
Das ist Science Fiction, Yuri!
21/09/2025 um 11:51 Uhr #416168Solche Behörden gibt es wirklich, die für die innere Sicherheit und die Früherkennung zuständig sind, Molly.
21/09/2025 um 18:23 Uhr #416200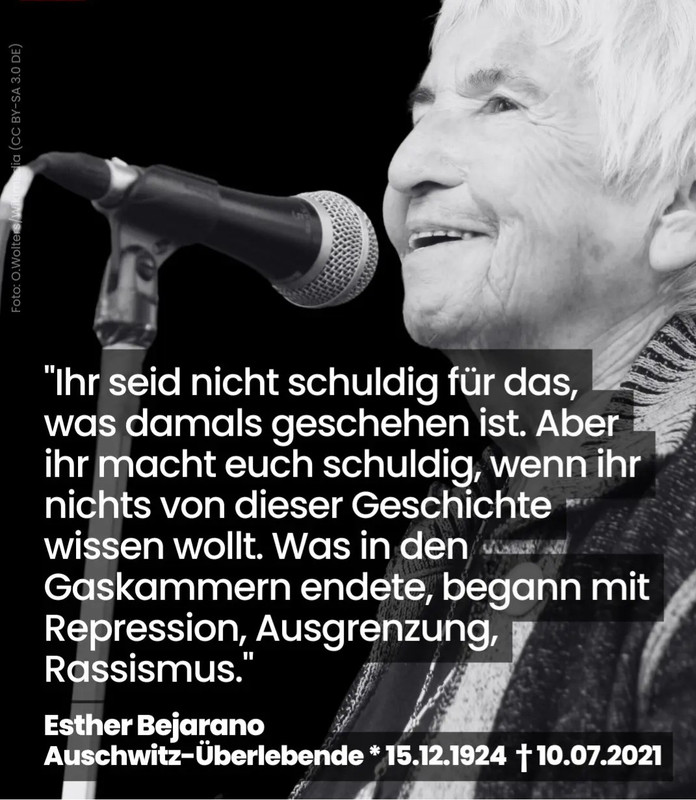
Petition für einen Wandel im psychiatrischen Gesundheitswesen und in der Psychopharmakologie – an die WHO und weitere:
21/09/2025 um 19:41 Uhr #416207Das grenzt ja schon an Populismus.
Also ob so ein komplexes Thema in einem Meme darstellbar wäre.Ich glaube, dass es gut ist zu diskutieren, ob Registrierung Sinn macht, aber auch welche Alternativen es vielleicht dazu gäbe.
Ich selbst denke, dass es für Menschen, die gewaltätig auffallen, eine andere Form der Betreuung nochmal geben sollte. Psychiatrisch engmaschiger, aber auch in Form von Sportangeboten wie Boxen.
Nicht alle psychiatrischen Straftäter sind Psychotiker – das schrieb ich ja schon am Anfang. Viele junge Menschen in Gefängnissen – vor allem Männer, haben zum Beispiel einen Borderline Hintergrund.Gerade bei so einer Impulssteuerungsproblematik fände ich es gut, wenn diesen Menschen Angebote gemacht würde. Das ist ja nicht nur zu aller möglichen Leute Sicherheit, sondern für diese oft jungen Menschen eine Chance eben nicht (wieder) gewalttätig zu werden.
21/09/2025 um 21:25 Uhr #416211Äpfel mit Birnen zu vergleichen, hat noch nie was gebracht!
28/09/2025 um 22:47 Uhr #416727Kampf um die Bedeutung des Wahnsinns: Ein Interview mit Dr. John Read
Akansha Vaswani interviewt Dr. John Read über die Einflüsse auf seine Arbeit und seine Forschung zu Wahnsinn, Psychose und der psychiatrischen Gesundheitsbranche.
Mad in America, 08. Mai 2019, von Akansha Vaswani (Längeres Interview)
(Automatisch übersetzt auf Deutsch)
Diese Woche interviewte Akansha Vaswani von MIA im Radiosender MIA Dr. John Read, einen klinischen Psychologen an der University of East London, über die Einflüsse, die seine Arbeit und Forschung zur psychischen Gesundheit im Laufe der Jahre beeinflusst haben.
John arbeitete fast 20 Jahre als klinischer Psychologe und Leiter psychiatrischer Dienste in Großbritannien und den USA, bevor er 1994 an die University of Auckland in Neuseeland wechselte, wo er bis 2013 tätig war. Er hat über 140 Artikel in Forschungszeitschriften veröffentlicht, hauptsächlich zum Zusammenhang zwischen negativen Lebensereignissen (z. B. Kindesmissbrauch/-<wbr />vernachlässigung, Armut usw.) und Psychosen. Er erforscht außerdem die negativen Auswirkungen biogenetischer Kausalerklärungen auf Vorurteile, die Meinungen und Erfahrungen von Patienten mit antipsychotischen und antidepressiv wirkenden Medikamenten sowie die Rolle der Pharmaindustrie in der Forschung und Praxis der psychischen Gesundheit.
John ist Mitglied des Vorstands des Hearing Voices Network – England, des International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal und der britischen Niederlassung der International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis (www. isps. org) (Link am Ende des Artikels in der Quelle zu finden, wie alle Links, die ich wegen der Forensoftware aus der Übersetzung entfernt habe.) Er ist Herausgeber der ISPS-Fachzeitschrift „Psychosis“.
Es folgt eine Abschrift des Interviews, die aus Gründen der Übersichtlichkeit bearbeitet wurde.
****************
AV: Vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns sind, Dr. Read. Wir würden heute gerne mehr über Ihre vielfältigen Forschungsgebiete erfahren. Bevor wir uns damit befassen, möchte ich Sie fragen, wie und warum Sie angefangen haben, die gängigen psychiatrischen Praktiken zu kritisieren? Welche Fragen haben Sie anfangs fasziniert, als Sie als klinischer Psychologe zu arbeiten begannen?
JR: Okay. Ich glaube, ich bin zur Psychologie gekommen, weil ich wie die meisten Teenager viel Zeit damit verbracht habe, herauszufinden, warum alle Erwachsenen so durcheinander waren – wenn ich einen guten Tag hatte. An einem schlechten Tag habe ich viel Zeit damit verbracht, herauszufinden, warum es mir so schlecht ging. An den meisten Tagen schien die ganze Welt ein ziemliches Chaos zu sein.
Die Kommunikation in meiner eigenen Familie lief nicht gut. Ich vermutete, dass das daran lag, dass mein Vater im Zweiten Weltkrieg Kampfpilot war und ständig enge Freunde verlor oder vom Himmel geschossen sah. Er war ziemlich verschlossen, und das war verständlich, aber das wusste ich als Kind nicht. Er hat es mir später erklärt. Ich glaube, in dieser Generation gab es solche Probleme häufig.
Ich glaube, die meisten Teenager haben manchmal damit zu kämpfen, und ich dachte – zu Recht oder zu Unrecht –, dass ein Psychologiestudium, um mich selbst und andere besser zu verstehen, eine Möglichkeit wäre, damit umzugehen. Leider habe ich im Psychologiestudium nicht viel darüber gelernt. Es drehte sich alles um Wahrnehmung, Ratten und Gott weiß was noch. Abgesehen von einem wichtigen Einfluss während des Studiums.
Ich glaube, ich bin eher zufällig auf die Schriften von Ronald Laing gestoßen. In den 1960er und 1970er Jahren war er ein Psychiater, der zumindest für unsere Generation die Ursachen des Wahnsinns nachvollziehbar darstellte. Er schrieb wunderbare Bücher über Familien und wie „verrückte“ Menschen, wenn man sie im Kontext ihrer Familie sieht, gar nicht mehr so verrückt wirken. Das hat mich stark beeinflusst, und schließlich bin ich in die USA gegangen, um dort eine Ausbildung zum klinischen Psychologen zu machen.
AV: Sie haben also als Student RD Laing gelesen?JR: Ich habe RD Laing während meines Studiums entdeckt. Es war das einzige Werk in den drei Jahren Psychologie, das mich irgendwie interessierte. Der Rest, sogar die sogenannte „abnorme Psychologie“, drehte sich ausschließlich um Diagnosen und hätte genauso gut ein Psychiatrie-Lehrbuch sein können, was im Grunde immer noch der Fall ist.
Interessanterweise sind die meisten Psychologie-Lehrbücher schrecklich biologisch und enthalten sehr wenig Psychologie. Also, ja, Laing entdeckte ich im Alter von etwa zwanzig Jahren und später in meinem Leben hatte ich das Glück, ihn zu treffen und kurz vor seinem Tod einige Zeit mit ihm zu verbringen, was eine große Ehre und ein Privileg war.
AV: Sie sagten, dass ein Bereich, über den Sie gelesen haben, anders war, der Einfluss der Familie auf die Entwicklung von Schwierigkeiten. Welche anderen Dinge, die damals nicht biologischer Natur waren, haben Ihr Interesse geweckt?JR: Nun, damals fand ich „Verrücktheit“ einfach immer interessant. Ich glaube, die meisten Menschen finden Wahnsinn interessant. Es gibt zwei Arten von Interesse: die Art von Interesse, die einem Angst macht oder leider dazu führt, dass man Abstand halten möchte, und die Art von Interesse, die einen dazu bringt, näher heranzukommen. Ich weiß nicht genau, warum, aber ich wollte dem immer nahe genug kommen.
Ich fand es einfach interessanter als Depressionen, Angstzustände und solche Sachen. Als ich Medizinstudent war und wir unser erstes Vorstellungsgespräch vor dem gesamten Personal durch einen Einwegspiegel führen mussten, hatten alle meine Kollegen panische Angst, dass jemand mit einer Psychose auftauchen würde, und ich hatte panische Angst, dass jemand ohne Psychose auftauchen und sich hinsetzen und sagen würde: „Ich bin depressiv, weil meine Freundin mich verlassen hat“, und ich würde sagen: „Na und?“ (lacht).
Natürlich sind Depressionen und Angstzustände sehr ernste Dinge. Aber ich fand es immer viel interessanter, Stimmen zu hören und zu glauben, dass die CIA es auf einen abgesehen hat und dass rote Lastwagen eine besondere Bedeutung haben. Ich glaube, vielleicht, weil ich mich manchmal selbst ein bisschen verrückt fühlte. Seit meinem allerersten Job (genauer gesagt, vor meinem Aufbaustudium arbeitete ich ein Jahr lang in der psychiatrischen Abteilung des Montefiore Hospital in New York) habe ich das, glaube ich, wirklich genossen. Teilweise, weil es beruhigend war zu wissen, dass es noch „verrücktere“ Menschen gab als ich, sodass sie mir nicht so seltsam oder merkwürdig vorkamen. Die Vorstellung, zum Beispiel viel Zeit mit Selbstmordgedanken zu verbringen, ich meine, darüber hatte ich als Teenager ziemlich viel nachgedacht.
Aber ich glaube, das geht vielen Teenagern so. Ich glaube, meine Faszination lag zum Teil in meinen eigenen Angelegenheiten begründet, im Versuch, meine eigenen Schwierigkeiten, Ängste und all das zu verstehen. Zum anderen war es einfach faszinierend, warum manche Menschen Stimmen hören, die andere nicht hören können. Damals wusste ich noch nicht, dass das nur in Industrieländern als Krankheitszeichen gilt.
In den meisten Kulturen gilt das als völlig normal. Manche Menschen hören Stimmen, andere nicht. Ich greife also etwas vor: Ich verbrachte 20 Jahre in Neuseeland, und die Maori hielten es für völlig normal, Stimmen zu hören, und machten sich Sorgen um Menschen, die keine Stimmen hören. Aber damals wusste ich davon nichts.
AV: Es klingt also, als ob es Ihnen ein gewisses Maß an Trost gefiel, von Wahnsinn umgeben zu sein.JR: Ja, das ist eine gute Art, es auszudrücken. Natürlich kann es auch Angst machen. Ich möchte es nicht unnötig romantisieren, denn manche Menschen hören absolut furchterregende Stimmen, die ihnen schreckliche Dinge sagen, damit sie sich selbst und anderen wehtun. Aber sie hören auch gute Stimmen, Stimmen, die sie beruhigen und ihnen sagen, dass alles gut wird.
Irgendwann verstand ich, dass es Träumen sehr ähnlich ist – nur eben, wenn wir wach sind. Ehrlich gesagt haben wir alle Träume, die ziemlich psychotisch sind. Seit Freud akzeptieren wir, dass sie eine Bedeutung haben, wenn wir sie verstehen. Aber wenn wir diese Erfahrungen im Wachzustand machen, wird uns gesagt, dass sie bedeutungslos sind. Irgendetwas stimmt einfach nicht mit unserem Dopaminsystem. Es hat nichts mit unseren Lebenserfahrungen oder unseren Umständen zu tun, was natürlich Unsinn ist, denn alle Beweise zeigen, wie ich jetzt weiß, dass es alles mit unseren Lebenserfahrungen zu tun hat.
AV: Mich würde interessieren, ob Sie, als Sie damals mit Ihren eigenen Problemen zu kämpfen hatten, jemals ein Etikett bekommen oder in irgendeiner Weise diagnostiziert wurden?JR: Nein, ich habe es geschafft, psychiatrische Dienste zu meiden. Ich war an der Uni bei einem Berater. Ich erinnere mich, dass ich den Mut aufbrachte, zu einem Berater zu gehen, der mich eine Stunde lang behandelte und sagte, ich sei nicht verrückt genug. Es war viel los, und ich war nicht verrückt genug, um seine Dienste zu rechtfertigen (lacht). Ich wusste nicht, ob ich mich dadurch beruhigen lassen wollte oder nicht. Mit anderen Worten, er hatte mehr, mehr … er war damals ein Berater für die gesamte Uni, also war ich nicht ganz qualifiziert.
Also nein, ich habe nie eine Diagnose bekommen. Aber wie jeder von uns hätte ich, wenn ich mit der Psychiatrie in Berührung gekommen wäre, mehrere Diagnosen erhalten. Die meisten von uns stehen auf mehreren Seiten des Diagnose- und Statistikhandbuchs. Und wie ich meinen Studenten immer sage: Wenn Sie sich nirgendwo im DSM wiederfinden, müssen Sie sich wirklich ein Leben zulegen.
AV: Es bestätigt in gewisser Weise Ihre Persönlichkeit.JR: Ja, ja.
AV: Und nun zurück zu Ihrer Rückkehr: Sie kamen in die Vereinigten Staaten, um klinische Psychologie zu studieren. Was hat Sie dort beeinflusst?JR: Nun, ich hatte großes Glück, ich war an einer Universität in den USA, deren klinisches Programm wunderbar vielseitig war. Wir hatten Mitarbeiter, die sich mit Psychoanalyse, Rogerianismus und Behaviorismus auskannten. Die kognitive Therapie steckte noch in den Kinderschuhen – das war schon lange her. Aber es gab eine ganze Reihe unterschiedlicher Ansätze, die sich gegenseitig respektierten. Deshalb war ich für die Ausbildung aus Großbritannien weggezogen.
Zu diesem Zeitpunkt war die britische Ausbildung ausschließlich verhaltensorientiert. Sie versuchte, eine Wissenschaft zu sein und mit der Psychiatrie zu konkurrieren, weil sie die Psychiatrie für eine Wissenschaft hielt, was sie aber nicht war. Alles war also stark verhaltensorientiert, was zwar nützlich sein kann, aber eine sehr enge Sichtweise auf den Menschen darstellt. Es war eine wunderbare Ausbildung in vielen verschiedenen Modellen – Familientherapie, Paartherapie, Sexualtherapie. Ich hatte großes Glück und hatte nur eine kleine Gruppe von acht anderen Studenten, allesamt nette Menschen. Es war eine ganz besondere Zeit.
AV: Das waren also zwei Jahre, oder haben Sie dort promoviert?JR: Ich habe in klinischer Psychologie promoviert. Das waren also insgesamt fünf Jahre, Master und dann noch drei Jahre danach.
AV: Und was geschah danach? Wie ging es dann weiter?JR: Dann für eine Weile zurück nach England. Dort habe ich mehrere Jahre als klinischer Psychologe im NHS gearbeitet und dann ist unsere Familie (wir hatten kleine Kinder) nach Neuseeland gezogen, wo wir 20 Jahre verbracht haben und erst vor vier oder fünf Jahren nach England zurückgekehrt sind.
AV: Können Sie uns ein wenig darüber erzählen, welche Unterschiede Sie bei der Arbeit im NHS in England im Vergleich zur Arbeit in Neuseeland beobachtet haben?JR: Die Systeme der psychischen Gesundheitsversorgung sind sich tatsächlich sehr ähnlich. Neuseeland orientiert sich weitgehend am britischen Gesundheitssystem, daher dominiert in beiden Systemen das biologische Modell, die Übermedikation und die übermäßige Abhängigkeit von Diagnosen. Dennoch gibt es Gruppen wunderbarer Menschen oder kleine Gruppen, die trotz der zunichtemachenden Wirkung eines übermäßig medizinischen Modells versuchen, therapeutische Arbeit zu leisten.
Sie sind sich also ziemlich ähnlich. Wie ich bereits erwähnte, gab es in Neuseeland einen Unterschied in den Heilmethoden der Maori. Die Menschen dort bemühten sich sehr, diese in die psychiatrische Versorgung zu integrieren. Das hatte einen sehr positiven Einfluss, da sie einen viel ganzheitlicheren Ansatz verfolgen, der auch spirituelle Probleme berücksichtigt. Sie sehen das Problem nie bei einem Einzelnen, was ich sonst nirgendwo getan hatte. Es war jedoch sehr erfreulich zu sehen, wie diese ganze Kultur einfach davon ausging, dass man bei Problemen alle zusammenbringen und darüber reden muss.
Und wenn ich alle sage, meine ich alle. Sie hatten dieses Konzept von Fanaa, was so viel bedeutet wie erweiterte Familie. Sie kamen einfach zusammen; es konnten 10, 15 oder 20 Leute sein, und sie saßen einfach da und redeten darüber, was das Geschehen für den Einzelnen bedeutete, und über die generationenübergreifende Bedeutung. Sie versuchten herauszufinden, woher es kam. Ist es eine Art Geschenk? Ist es eine Art Strafe? Ich verstehe oder stimme nicht unbedingt mit all ihren Konzeptualisierungen überein, aber der Punkt ist, dass sie von der Prämisse ausgingen, dass, egal wie seltsam die Erfahrung auch sein mag, sie eine Bedeutung hat und dass diese Bedeutung gemeinsam herausgefunden werden kann.
Das war der Heilungsprozess, der so weit entfernt ist von der westlichen Sichtweise, dass ein biologisches Problem im Individuum selbst liege oder etwas mit seinem Gehirn oder seinen Genen nicht stimmte. Und die Antwort ist chemisch – ihre chemische Lösung oder Elektrizität funktioniert nicht. Niemand kann das zugeben. Das war also wunderbar. Obwohl die Maori natürlich eine schreckliche Zeit durch die Ankunft der Weißen und die Kolonisierung hatten. Heute gibt es in Neuseeland einen ernsthaften Versuch, sich zu integrieren und voneinander zu lernen. Und die Maori sind unglaublich. Ich weiß nicht, ob „verzeihend“ das richtige Wort ist, oder ob sie bereit sind, ihr Wissen zu teilen, was erstaunlich ist, wenn man bedenkt, wie sie behandelt wurden. Das war ein wichtiger Unterschied.
AV: Wie hat der Umgang mit Maori und ihren Praktiken Ihr Verständnis von Wahnsinn, Psychose oder Stimmenhören beeinflusst?JR: Nun, in gewisser Weise hat es die Sache nicht geändert, sondern eher bestätigt. Denn ich war immer davon ausgegangen, dass Stimmen und Wahnvorstellungen eine Bedeutung haben und aus Lebenserfahrungen stammen. Wenn man den Stimmen zuhört und die Person fragt, an wen sie sich erinnern, ergibt das meist durchaus Sinn. Nicht immer, und manchmal möchte die Person es einem vielleicht nicht sagen oder es selbst nicht wissen, weil Stimmen als Abwehr gegen Vergangenes wirken können.
Ich schätze, sie haben mich herausgefordert, weil ich immer davon ausgegangen war, dass Stimmen letztlich innere Erfahrungen sind, die wir auf die Welt projizieren und die wir dann als Antwort hören, die aber eigentlich Teil von uns selbst sind. Manche Maori verstehen das zwar irgendwie, aber andere sagen: „Nein, nein, das sind eigentlich Botschaften von Vorfahren, das verstehst du nicht, John.“ Ich wusste dann nicht, was ich damit anfangen sollte, weil ich nicht an so etwas glaube. Das heißt aber nicht, dass sie recht haben oder ich recht habe. Es war also eine interessante Herausforderung, als sie sagten: „Nein, es ist nicht nur eine projizierte innere Erfahrung. Das sind echte Botschaften von echten Menschen, die manchmal tot sind.“ Ich musste das einfach ertragen, ohne es unbedingt zu glauben. Ich kann mich irren. Ich bin kein sehr spiritueller Mensch, ich wäre es gerne, aber … (lacht).
AV: Wenn Sie also mit jemandem zusammenarbeiten würden, der beispielsweise diese Überzeugung hat, könnten Sie damit leben?JR: Ja, und mir fällt gerade ein: Das einzige Mal, dass ich Stimmen gehört habe (und das widerspricht irgendwie dem, was ich gerade gesagt habe), war, als ein sehr, sehr guter Freund bei einem Autounfall ums Leben kam und er mich am Abend besuchte, um sich zu verabschieden. Ich werde immer noch ganz rührselig, wenn ich daran denke.
Als das passierte, bekam ich trotz all meines Wissens, meiner Erfahrung und meiner langjährigen Arbeit immer noch Angst und dachte, ich würde verrückt werden. Ich musste mich beruhigen und sagen: „Um Himmels willen, John, es ist egal. Entweder er ist da oder er ist nicht da. Setz dich einfach hin und hör ihm zu.“ Das macht irgendwie keinen Sinn, da ich nicht daran glaube (lacht), aber er kam trotzdem, um sich zu verabschieden, und damit ist die Sache erledigt.
AV: Ich meine, es passt in gewisser Weise zu dem, was Sie sagen. Es war eine so eindringliche Erfahrung, dass sie auf irgendeine Weise in Ihr Bewusstsein oder Unterbewusstsein eindrang.JR: Ja, ich denke, es geht einfach darum, die Erfahrungen anderer und ihre Erklärungen zu akzeptieren. Ein weiterer großer Einfluss auf mich in dieser Hinsicht war der amerikanische Psychiater Loren Mosher, der das Soteria-Haus gründete. Er richtete mehrere Häuser ein, in denen Menschen mit Schizophrenie-Diagnose einfach sein konnten, ohne behandelt zu werden oder zu versuchen, sie zu heilen.
Das Kriterium für die Arbeit dort war nicht, ob man einen Abschluss in Psychologie oder Psychiatrie hatte. Es war, ob man extreme Zustände ertragen konnte, ohne auszuflippen. Das war das Kriterium für die Arbeit dort. Er nannte es „mit jemandem zusammen sein“, was ein ziemlich einfacher Begriff ist, und es führte zu erstaunlichen, erstaunlichen Ergebnissen. Mindestens so wirksam wie die übliche Behandlung hinsichtlich der Symptome und weitaus wirksamer als die übliche Behandlung hinsichtlich der Lebensqualität, der Freunde und der Wiedereingliederung in den Beruf und dergleichen.
Also, es ist interessant, mir ist gerade aufgefallen, dass meine ersten beiden Referenzen, die ich für Sie identifiziert habe, beide Psychiater waren, was interessant ist, weil ich mein halbes Leben damit verbracht habe, die Psychiatrie als Beruf zu kritisieren und sie eine Pseudowissenschaft usw. zu nennen, aber so ist es nun einmal (lacht).
AV: Aber sie sind aus ihren eigenen Randbereichen herausgetreten …JR: Ja, das haben sie, und sie haben dafür auch einen Preis bezahlt. Loren Mosher war Leiter der Schizophrenieforschung am National Institute of Mental Health und ging mitten in seiner Forschungsarbeit im Soteria-Haus in Urlaub. Als er zurückkam, war sein Schreibtisch leergeräumt. Sie haben ihn einfach gefeuert, weil er gezeigt hatte, dass ein nicht-medizinischer, nicht-biologischer Ansatz besser wirkt als Medikamente. Das war für die Psychiatrie unerträglich, also haben sie ihn gefeuert.
Er schrieb das schönste Rücktrittsschreiben in der Geschichte der Rücktrittsschreiben an die American Psychiatric Association. Es begann mit den Worten: „Mir war nicht klar, dass die Buchstaben jetzt für American Psychopharmacological Association stehen.“ Ich empfehle jedem, sich das Rücktrittsschreiben von Loren Mosher (Link folgt im nächsten Beitrag) anzusehen .
AV: Vielleicht fügen wir in dieser Folge einen Link dazu ein. Da ich gerade von Ihnen höre, frage ich mich, warum wir als Gesellschaft Ihrer Meinung nach so große Angst davor haben, nicht-biologische Interpretationen der psychischen Gesundheit zu akzeptieren?JR: Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die einfache Antwort ist die Macht der Pharmakonzerne und ihre endlose Propaganda, vor allem in Amerika, mehr noch als anderswo. Ihr Einfluss auf die Psychiatrie, die vor dreißig oder vierzig Jahren ihre Seele an die Pharmakonzerne verkauft hat und inzwischen vergessen hat, was eine angemessene professionelle Abgrenzung zu einer profitorientierten Organisation ist. Das ist eine Ebene – eine sehr mächtige politische und wirtschaftliche Kraft –, die vereinfachende biologische Erklärungen für menschliches Leid fördert.
Auf einer eher psychologischen Ebene glaube ich, dass es für uns alle, wenn wir in Not sind, etwas Anziehendes hat, nicht an die schlechten Dinge denken zu müssen, die in unserem Leben passiert sind, an die schlechten Dinge, die jetzt in unserem Leben passieren, an unsere Ängste, an die Dinge, die wir an uns selbst nicht mögen, und an all das eklige Zeug, das schmerzhaft und beunruhigend ist. Es ist anziehend, es einfach zu akzeptieren: Ich habe dieses Problem, ich habe diese Diagnose, diese Krankheit oder so etwas. Ich kann nichts dafür. Es ist nicht meine Schuld. Es ist ganz einfach: Ich weiß, was ich habe. Ich weiß, was mich aufregt, und ich kenne die Lösung.
Es ist intellektuell wunderbar einfach, aber auch emotional. Man muss nichts fühlen und nichts erforschen. Es ist die schnelle Lösung, und ich denke, wir alle tragen eine gewisse Verantwortung dafür. Ich meine, wir alle gehen, wenn wir verzweifelt sind, zum Hausarzt, der Arzt ist, obwohl es sich nicht um medizinische Phänomene handelt. Das sind menschliche Reaktionen auf das Leben, denke ich. Wir alle rennen zum Hausarzt und erzählen es ihm und sind enttäuscht, wenn er uns nichts verschreibt.
Ich finde, es hat auch etwas Beruhigendes, ein medizinisches Etikett zu haben. Zumindest kurzfristig zeigt es einem, dass andere Menschen dasselbe haben und man nicht allein ist. Es suggeriert einem, dass der Arzt weiß, was los ist. Jetzt geht man zum Arzt, und das Schlimmste, was man hören möchte, nachdem man ihm erzählt hat, was einem fehlt, ist: „Ich weiß nicht, was das ist, das habe ich noch nie gesehen.“ Das ist beängstigend.
Zu hören: „Sie haben eine schwere depressive Störung“ oder „Sie haben eine Borderline-<wbr />Persönlichkeitsstörung“ – all diese eher nichtssagenden Bezeichnungen, die wie medizinische Diagnosen klingen, es aber natürlich nicht sind und kaum wissenschaftlich fundiert sind – kann kurzfristig durchaus beruhigend sein. Zumindest bis man das Stigma erkennt, das damit einhergeht, und die Tatsache, dass sie eigentlich überhaupt nichts erklären. Aber es ist verlockend. Es ist einfach. Man muss sich nicht mit den komplizierten Details auseinandersetzen.
Auch politisch ist es attraktiv für Politiker. Nehmen wir an, die neuesten Zahlen aus England zeigen, dass mittlerweile jeder Sechste Antidepressiva nimmt. Bei Ihnen ist es ähnlich, die Werte sind ähnlich. Nehmen wir nun an, es besteht ein echter Bedarf: Jeder Sechste von uns ist tatsächlich so klinisch depressiv, dass er eine chemische Behandlung braucht, was natürlich trotz Brexit, Trump und all den deprimierenden Dingen, die gerade passieren, absoluter Unsinn ist.
Ich glaube nicht, dass jeder Sechste von uns klinisch depressiv ist. Nehmen wir an, wir wären es – das würde bedeuten, dass die Politiker etwas unternehmen müssten, wenn diese Dinge gesellschaftliche Ursachen haben. Sie müssten etwas gegen die sozialen Ursachen von Depressionen unternehmen, wie Armut, Kindesmissbrauch, Gewalt gegen Frauen und all diese Dinge.
Aber wenn wir uns selbst und die Politiker davon überzeugen können, dass es sich hier nicht um soziale Probleme, sondern um Krankheiten handelt, lässt sich das nicht verhindern. Es gibt einfach einen gewissen Anteil an Menschen, die genetisch dazu veranlagt sind, depressiv zu werden. Dann brauchen wir nicht mehr Geld in die ersten fünf Lebensjahre unserer Kinder zu investieren. Wir müssen weder die Armut noch die Gewalt reduzieren usw. Politisch gesehen ist das biologische Modell für Politiker also sehr praktisch. Sie müssen nichts gegen all das menschliche Leid tun.
Aus diesen Gründen und weil es sich um ein sehr leistungsfähiges und attraktives Modell handelt, ist es so schwer, es zu widerlegen, obwohl alle Forschungsergebnisse zeigen, dass es falsch ist – und es gibt nur sehr wenige Belege. Sie räumen jetzt ein, dass kein chemisches Ungleichgewicht für Depressionen verantwortlich ist, wie sie es seit 30 bis 40 Jahren vertreten. Wir hören jetzt sogar: „Wir haben nie behauptet, dass Depressionen durch ein biochemisches Ungleichgewicht verursacht werden. Das sind die Mythen, die Antipsychiater wie Sie, John, verbreiten: Wir haben immer behauptet, es liege ein chemisches Ungleichgewicht vor“, was einfach bizarr ist.
Erst gestern ließ die BBC, die normalerweise eine recht gute und zuverlässige Informationsquelle ist, einen unserer führenden Psychiater verkünden, wie man in einem Petriglas mit Chemikalien Depressionen auslösen kann (lacht). Unglaublich. Und er sagte, dass die meisten depressiven Menschen in England noch keine Antidepressiva nehmen. Dabei nimmt bereits jeder Sechste Antidepressiva.
Das heißt, er hat dem Land gerade auf unserem angesehenen BBC-Kanal mitgeteilt, dass mehr als ein Drittel der Betroffenen Antidepressiva nehmen sollten. Genau das hat er gesagt. Und da diese Medikamente Frauen doppelt so häufig verschrieben werden wie Männern, empfiehlt er damit offensichtlich, dass jede zweite Frau Antidepressiva nehmen sollte. Das ist bizarr. Er behauptet buchstäblich, den Leuten die chemischen Zusammenhänge hinter Depressionen zu erklären.
AV: Das ist wirklich interessant. Wir haben über die Gründe gesprochen, warum wir nicht-biologischen Erklärungen nicht zustimmen wollen, und während Sie sprachen, dachte ich auch an Familienmitglieder. Denn – um auf das zurückzukommen, was Sie vorhin über die Familie gesagt haben – wenn jemand verzweifelt ist und der Psychiater oder Arzt ihm ein Diagnosezeichen gibt, sind auch die Familienmitglieder beruhigt.JR: Ja, ja, und so kommen sie an Kinder, nicht wahr, zum Beispiel an ADHS? Zeigen Sie mir ein Kind mit ADHS-Diagnose, und ich zeige Ihnen eine Familie, die Hilfe braucht. Eines der Probleme, die Familie als Ursache oder Lösung zu sehen, besteht darin, dass dies als Schuldzuweisung an die Familie angesehen wird, obwohl uns immer wieder gesagt wird, wir dürften nicht die Familien beschuldigen. Das ist ja schön und gut, aber manchmal brauchen Familien tatsächlich Hilfe.
Kindererziehung ist nicht immer einfach, und wenn man ein Kind hat, das aus irgendeinem Grund etwas aktiver oder ungeduldiger ist als andere, ist es schwierig. Die Lösung ist jedoch nicht, ihnen Amphetamine zu geben. Ich habe gelesen, dass in einigen US-Bundesstaaten mittlerweile jeder vierte Junge unter elf Jahren Ritalin nimmt. In England ist es nicht ganz so schlimm, aber wir holen leider schnell auf.
Aber die Vorstellung, dass problematische Kinder psychisch krank sind, ist besonders beunruhigend. Und dann gibt es noch Lehrer, die genau danach Ausschau halten und Diagnosen stellen, obwohl sie gar nicht vorhanden sind. ADHS hat eine interessante Geschichte. Während meiner Ausbildung lautete die Diagnose „minimale Hirnfunktionsstörung“. Es stellte sich heraus, dass die Störung so minimal war, dass sie sie nicht feststellen konnten. Also änderten sie die Diagnose in ADHS.
Aber ja, Sie haben Recht, Familien können es beruhigend finden, wenn ihre Kinder ein psychiatrisches Etikett haben, das alle Probleme der Familie erklärt. Ronnie Laing und andere schrieben in den 60er Jahren, ebenso wie Lyman Wynne und Familientherapeuten viel über den identifizierten Patienten, und wir haben in meiner Ausbildung viel darüber gelernt. Heute wird nicht mehr so viel darüber gesprochen, aber die Funktion einer Person in der Familie, die „durcheinander“ ist, besteht darin, die Probleme aller anderen zu erklären: „Wenn der kleine Johnny nur kein ADHS hätte, wäre unsere Beziehung in Ordnung. Der kleine Johnny stresst uns so.“ Dabei könnte es durchaus auch umgekehrt sein.
AV: Richtig, und ich denke, um das auf etwas auszuweiten, was Sie vorhin gesagt haben: Viele Familien mit Problemen leben auch in einer Gesellschaft, die viele Probleme hat. So werden beispielsweise Familien, die in Armut leben, häufiger diagnostiziert. Auch hier gibt es also einen wechselseitigen Einfluss. Selbst wenn wir uns Familien ansehen und darüber nachdenken, wie wir dies ohne Pathologisierung von Familien tun können, denke ich, dass es sich um ein soziales und nicht um ein familiäres Problem handelt.JR: Das stimmt. Psychische Probleme kommen in armen Familien viel häufiger vor. Armut ist statistisch gesehen der stärkste Prädiktor für so ziemlich alles. Sicherlich gesundheitliche Probleme, Depressionen, Psychosen, aber Sie haben auch gesagt, dass die Probleme, mit denen Familien zu kämpfen haben, meist generationenübergreifend sind.
Alle Eltern geben per Definition ihr Bestes. Die meisten Eltern, denen die Erziehung schwerfällt, hatten wahrscheinlich selbst eine schwierige Kindheit und wurden nicht besonders gut erzogen. Daher haben sie kein Vorbild dafür, was gute Elternschaft eigentlich bedeutet. Es geht nicht darum, jemandem die Schuld zu geben. Es geht darum, generationsübergreifende Muster zu erkennen.
Sehr oft in Verbindung mit Armut, wie Sie erwähnten. Ich habe festgestellt, dass diese Muster durchbrochen werden können. Doch leider interessiert sich unser aktuelles Modell nur für die generationsübergreifende Genetik und die Illusion, dass diese Dinge – Depressionen, Schizophrenie oder was auch immer – genetische Komponenten haben. Und die Beweise dafür sind so schwach, dass es lächerlich ist.
Leider fließt immer noch ein Großteil der Gelder in die Genforschung. Selbst in meinem eigenen Forschungsgebiet suchte man in den ersten 80 Jahren seit der Erfindung des Gens nach „dem“ Schizophrenie-Gen. Das hat man schließlich aufgegeben und untersucht nun, vereinfacht gesagt, die Wechselwirkungen vieler kleinerer Gene.
Ich habe kürzlich auf einer Konferenz gefragt, wie lange sie noch brauchen würden, um diese Forschung abzuschließen. Die Antwort war: „Oh, ungefähr 20 Jahre.“ Ich fragte: „Wie viel der Varianz hätten Sie Ihrer Meinung nach am Ende tatsächlich erklären können?“ Sie meinten – sie hatten eine große Diskussion auf einer kleinen Konferenz – und dann: „Ungefähr 17 %.“ Ich fragte: „Können wir dann das ganze Geld zurückbekommen – die Abermillionen, die verschwendet wurden?“
Was hätten sie denn tun sollen, wenn sie das Schizophrenie-Gen gefunden hätten? Wollten sie den Genpool einschränken? Nun, ich meine, in Ihrem Land gibt es genetische Beratung. Ich halte es für völlig unethisch, Leute einfach hinzusetzen und zu sagen: „Weil Sie an Schizophrenie leiden, sollten Sie vielleicht darüber nachdenken, keine Kinder zu bekommen.“ Das ist entsetzlich.
AV: An dieser Stelle wäre es interessant, wenn Sie etwas über Ihre Traumaforschung erzählen könnten. Wir sprachen über Familie und die Auswirkungen von Armut, und ich weiß, dass Sie viel über die Auswirkungen traumatischer oder negativer Erfahrungen auf psychische Probleme geforscht haben.
JR: Ja. Meistens im Zusammenhang mit Psychosen. Das alles entstand während meiner zwanzigjährigen Tätigkeit als klinischer Psychologe oder Leiter psychiatrischer Dienste in den USA, Neuseeland und später England. Immer wieder begegnete ich Menschen, die ziemlich psychotisch waren, aber wenn man eine Beziehung zu ihnen aufbauen konnte – und das ist manchmal der schwierige Teil – erzählten sie einem ihre Lebensgeschichte. Nicht immer, aber sehr, sehr oft waren ziemlich schlimme Dinge passiert. Es hing eindeutig mit den Stimmen zusammen, die sie hörten und so weiter.
Als ich nach 20 Jahren als klinischer Psychologe wieder in die Wissenschaft zurückkehrte, wollte ich genau das erforschen. Ich war überrascht, denn es gab zwar einige Studien, die Kindesmissbrauch mit Psychosen in Verbindung brachten, aber niemand hatte sie überprüft oder zusammengetragen. Also haben wir uns 1997 zuerst damit beschäftigt.
Es ist lange her; wir haben diese Reise begonnen und einige kleinere Studien zum Zusammenhang zwischen körperlicher und sexueller Kindesmisshandlung durchgeführt. Vernachlässigung und emotionale Misshandlung haben wir etwas zögerlich einbezogen. Der Zusammenhang war, egal wie man ihn betrachtete, sehr stark. Weltweit begannen immer mehr Menschen, dies zu tun, und 2005 veröffentlichten wir die erste groß angelegte Literaturübersicht, die das Thema wirklich in den Fokus rückte.
Körperlicher und sexueller Missbrauch von Kindern sind ein unglaublich starker Prädiktor für Psychosen, egal wie man ihn misst. Ob man den diagnostischen Weg geht, der nicht wirklich wissenschaftlich ist, oder ob man den Zusammenhang mit spezifischen Erfahrungen, wie Stimmenhören oder paranoiden Wahnvorstellungen, untersucht, der Zusammenhang ist extrem, extrem stark. Viel stärker als alles Ähnliche auf der biologischen Seite biogenetischer Prädiktoren.
Das war natürlich von Anfang an ziemlich umstritten, und uns wurde der Vorwurf gemacht, die Familie würde die Schuld geben. Man hörte: „Man sollte mit Schizophrenen nicht über solche Dinge reden. Das würde sie nur aufregen.“ Man hörte: „Das kann man ihnen nicht glauben. Wenn sie erzählen, dass sie als Kind missbraucht wurden. Das ist Teil ihrer Krankheit.“ Das macht mich extrem wütend. Das ist die ultimative Form der Schuldzuweisung an das Opfer.
Es ist also nicht nur so, dass Menschen diese schrecklichen Erfahrungen gemacht haben und dadurch „verrückt“ geworden sind, sondern die Menschen, die sie eigentlich heilen sollten, behaupten auch noch, es sei nicht passiert. Das ist unverzeihlich. Von allem, was Psychiater tun, macht mich das am wütendsten. Ich denke, es ist jetzt etwas besser, auch weil wir es geschafft haben, das Thema auf die Tagesordnung zu bringen. Es wird nicht mehr so kontrovers gesehen wie vor 20 Jahren.
Auf der anderen Seite dieser Forschung stehen die Ansichten der Öffentlichkeit über die Ursachen des Wahnsinns, und ich werde diese beiden Dinge zusammenführen. Wenn man die Öffentlichkeit mithilfe von Umfragen weltweit nach den Ursachen von Psychosen (oder überhaupt allen möglichen Erkrankungen, sicherlich Depressionen, aber auch Psychosen und Schizophrenie) fragt, antworten die Menschen in allen Ländern außer einem – und Sie werden vorhersagen können, welches Land das ist – derzeit 24 Ländern, dass es soziale Ursachen sind.
Sie sagen, Einsamkeit, Armut, Missbrauch, Gewalt, Krieg, Traumata, Vergewaltigung und Stress am Arbeitsplatz seien die Ursachen. Ganz unten auf ihrer Liste stehen auch biogenetische Faktoren. Sie glauben nicht, dass alles psychosozial ist, aber ihr grundlegendes Verständnis von Wahnsinn ist, dass schlimme Dinge passieren und uns verrückt machen.
Die Ausnahme bilden unsere befreundeten USA. Ich denke, das liegt vor allem an der ständigen Bombardierung durch Pharmavertreter und das Fernsehen und daran, dass sie ein am stärksten biologisch geprägtes Psychiatriesystem und Weltbild haben. Doch im Großen und Ganzen ist die Vorstellung, dass uns schlimme Dinge in den Wahnsinn treiben, nur einer einzigen Berufsgruppe fremd.
Nur 1 % der im Bereich der psychischen Gesundheit tätigen Menschen, also der Psychiater, begreifen nicht, dass Wahnsinn in erster Linie durch zwischenmenschliche Interaktionen und schlechte Dinge, die Menschen einander antun, oder durch unglückliche Ereignisse wie Verluste usw. verursacht wird. Sie stehen im völligen Widerspruch zum Rest der Bevölkerung und damit auch zu ihren Patienten, weil sie diesen Aspekt einfach nicht begreifen können.
Sie haben keine Ahnung von dem, was sie Antipsychiatrie nennen, mit dem sie jeden abweisen, der sie kritisiert. Sie begreifen nicht, dass die Menschen, ihre Familien und so ziemlich jeder Mensch eine Begründung haben. Wenn man Stimmen hört oder paranoid ist, liegt das daran, dass Schlimmes passiert ist. Sie sind die Einzigen, die das nicht verstehen, und sie haben eine wunderbare Abwehr dagegen. Denn wenn man da sitzt und sagt: „Nein, Doktor, eigentlich höre ich Stimmen, weil mir dies und jenes passiert ist“, sagen sie: „Ah, Ihnen fehlt also auch die Einsicht“, was ein Symptom der Krankheit ist, die man angeblich nicht hat. Da gibt es keinen Ausweg.
Es ist eine böse Sache, jemandem etwas anzutun, der verletzlich und aufgebracht ist und versucht, Ihnen seine Geschichte zu erzählen und sagt: „Nein, ich habe keine Schizophrenie. Mit meinem Gehirn ist alles in Ordnung. Es ist nur so, dass mir dies und jenes passiert ist.“ Und das beweist dann, dass Sie krank sind. Das ist eine schreckliche Sache.
AV: Es ist ein Machtgefälle, nicht wahr? Denn wenn der Arzt Ihnen das sagt, werden Sie Ihre Meinung oder Erklärung gegenüber jemandem abwerten, der es besser weiß und das schon einmal gesehen hat, wie Sie vorhin angedeutet haben .JR: Ja. Das ist nicht in Ordnung. Es muss für sie auch sehr unbefriedigend sein, denke ich, weil sie nie die Nähe erleben, die Psychologen, Therapeuten, Berater und Menschen im Allgemeinen erfahren, wenn man mit jemandem zusammensitzt, der einem am Herzen liegt, und versucht zu verstehen, was mit ihm los ist, und man hört sich seine Geschichte aufmerksam an und versucht, gemeinsam mit ihm einen Sinn darin zu finden. Das erleben sie nicht.
Sie erleben nur diese Angst und Distanz und diese Objektivierung der Menschen. Es muss ein schrecklich unbefriedigender Job sein, denke ich. Dann werden sie auch noch kritisiert und haben keine Ahnung, was das soll. Sie können es nicht begreifen: „Warum sind die Leute so böse auf uns?“
Es ist eigentlich ziemlich komisch, denn was sie damit machen, ist dasselbe, was sie mit dem Leid machen, von dem sie Abstand halten wollen – sie etikettieren es, sie nennen es Antipsychiatrie. Sie sagen: „Ah, jetzt weiß ich, warum du sauer auf mich bist. Du hast dieses Ding namens Antipsychiatrie, das dich mein Urteilsvermögen in Frage stellen lässt. Aah, aah, jetzt ergibt alles einen Sinn.“ Es ist so erbärmlich.
AV: Ich habe etwas von Ihnen aus dem Jahr 2005 gelesen. Das hier war meine Lieblingszeile aus einem kurzen Artikel (Link golgt im nächsten Beitrag) der British Psychological Society. Dort hieß es: „Lebensereignisse werden zu Auslösern einer genetischen Zeitbombe degradiert.“ Ich glaube, Sie haben Recht. Wir sprechen hier eher über Traumata, Stress und negative Ereignisse, aber eher im Sinne des (ich glaube, so heißt der Artikel) Bio-Bio-Bio-Modells des Wahnsinns.JR: Nun, das war nicht mein Satz. Ich habe ihn geklaut. Ich muss Anerkennung zollen, wo Anerkennung gebührt. Der Satz stammte vom damaligen Vorsitzenden der American Psychiatric Association – Steven Sharfstein –, einem sehr mutigen Psychiater, der einen Artikel in Psychiatry News schrieb . Er versuchte, seinen Kollegen zu sagen, sie sollten aufwachen und nicht so passiv gegenüber der Rolle der Pharmakonzerne usw. sein. Er benutzte den Begriff „Bio-Bio-Bio-Modell“ – nur um Anerkennung zu zollen, wo Anerkennung gebührt.
Ja, diese genetische Zeitbombe. In allen Lehrbüchern – Psychologie, Krankenpflege und Psychiatrie – geht es um das biopsychosoziale Modell und das Stress-Vulnerabilitäts-Modell. Die Leute sagen: „Ach, das haben wir doch schon behandelt. Das Psychosoziale haben wir im biopsychosozialen Modell behandelt.“ Aber diese Theorie besagt einfach, dass diese Dinge ohne genetische Veranlagung nicht gelten. Und das ist auch eine Lüge – das Alter hat auch Nachteile, weil man sich an diese Dinge erinnert.
Als zwei Psychiater (Zubin und Spring) (Link inter Quelle) 1977 die erste Arbeit über ihr biopsychosoziales Stress-Vulnerabilitätsmodell der Schizophrenie schrieben, sagten sie, dass der Vulnerabilitätsanteil in dieser Stress-<wbr />Vulnerabilitätsgleichung nicht vererbt werden muss. Er kann durch ein Trauma erworben werden.
Beide Seiten der Gleichung können also stressbedingt sein. Das ist auch klar: Wer als Kind im Alter von zwei, drei und vier Jahren wiederholt schlimme Belastungen erlitten hat, wird mit acht, zehn, zwanzig usw. anfälliger für Stress sein. Das Stress-Verletzlichkeits-Modell kann also nur auf Stress beruhen, aber die biologischen Psychiater haben diese Idee einfach geklaut und gesagt: „Na ja, die Veranlagung, der Verletzlichkeitsteil ist offensichtlich genetisch bedingt.“ In diesem Modell sagten Zubin und Spring, dass Verletzlichkeit erworben werden kann. Davon wird heute nichts mehr gesagt. Es ist einfach verschwunden. Es wurde aus der Geschichte getilgt.
AV: Diese Themen werden in der Branche schon lange diskutiert, und nun sind wir 2019 an diesem Punkt angelangt. Wohin gehen wir Ihrer Meinung nach von hier aus? Ich weiß, dass Sie viel forschen, und es gibt Kollegen von Ihnen, die ebenso viel forschen und das, worüber wir heute gesprochen haben, in den Vordergrund rücken. Wohin müssen wir uns Ihrer Meinung nach bewegen? Wohin bewegen wir uns Ihrer Meinung nach?JR: Zunächst einmal glaube ich nicht, dass sich durch die Forschung etwas ändern wird. Ich glaube nicht, dass wir mehr Forschung darüber brauchen, was welche Ursachen hat – ich denke, die Ursachen sind ziemlich klar. Die Barrieren für Veränderungen sind also nicht die Art von Barrieren, die durch Forschungsarbeiten abgebaut werden können. Ja, es ist wichtig, Forschung zu betreiben und das, worüber wir gesprochen haben, weiter zu etablieren, aber dadurch wird sich nichts ändern, denn wir stehen gegen die Pharmakonzerne.
Wir haben es mit einer mächtigen Berufsgruppe zu tun, die im Auftrag der Pharmakonzerne agiert und sich nicht im Geringsten für den Mangel an Beweisen für ihre Behandlungen schämt. Das scheint sie nicht zu kümmern. Psychiatrische Dienste basieren derzeit also nicht auf Beweisen. Sie müssen aus sozialem Kampf und Medienarbeit hervorgehen. So wie es Mad in America und seine Partnerorganisationen auf der ganzen Welt tun.
Die Arbeit des Hearing Voices Network ist eine der spannendsten Veränderungen im Bereich der psychischen Gesundheit. Sie würden sie, wie ich, nicht als psychiatrische Dienste bezeichnen, weil sie es nicht sind. Tatsächlich gibt es in 20 Ländern Menschen, die früher als schizophren abgestempelt, bis zum Gehtnichtmehr mit Medikamenten vollgepumpt und für weite Teile ihres Lebens eingesperrt wurden. Sie weigern sich, das alles mitzumachen und kommen zusammen, um sich gegenseitig zu unterstützen – in 20 Ländern! Das ist wirklich spannend. Dort wird sich etwas ändern, denn letztendlich müssen wir anfangen, einfach Nein zu Medikamenten zu sagen. Nicht immer. Manchmal können sie hilfreich sein, aber in dem Maße, wie wir uns als Gesellschaft selbst mit Medikamenten vollpumpen, ist es lächerlich.
Wir alle haben unseren Teil dazu beizutragen. Aber ich bin im Moment zuversichtlich. In Großbritannien habe ich mich in den letzten ein, zwei Jahren verstärkt mit Antidepressiva beschäftigt, was für mich relativ neu ist, weil es hier große Bestrebungen gibt, etwas gegen die Überverschreibung zu unternehmen, und neue Forschungsergebnisse zeigen, dass es den Menschen wirklich schwerfällt, von diesen Medikamenten loszukommen. Dabei ist das Thema gar nicht so neu – es gibt es schon lange, aber niemand hat es beachtet, und das Royal College of Psychiatry in Großbritannien leugnet die Entzugserscheinungen aktiv.
Wir erleben gerade eine kleine Wiederholung der Ereignisse mit Benzodiazepinen in den 1980er Jahren, als alle sagten: „Oh, die machen nicht süchtig, wo ist das Problem?“ Und genau das tun sie jetzt. Aber wir gewinnen, ganz klar. Die Medien berichten fast ständig über die Forschung.
Mein Kollege James Davies und ich haben weltweit Studien durchgeführt. Wir haben alle Studien ausgewertet. Sie zeigen, dass über die Hälfte der Menschen, die versuchen, Antidepressiva abzusetzen, Entzugserscheinungen haben, und etwa die Hälfte von ihnen beschreibt diese als schwerwiegend. Die nationalen Richtlinien behaupten das Gegenteil: Sie besagen, dass die Wirkung nur eine Woche anhält und sehr gering ist.
Es war ein interessanter Kampf, die Ursachen aufzudecken, denn wir haben etwas über die nationalen Leitlinien gelernt. Als diese 2009 verfasst wurden – wir nutzten hier den Freedom of Information Act – mussten sie unsere Fragen beantworten. Wir baten einige von ihnen, uns die Forschungsergebnisse zu schicken, die unsere nationalen Leitlinien stützen, und sagten, dass diese nur eine Woche gültig seien. Sie mussten zugeben, dass es keine gab, sie hatten sich die Leitlinien ausgedacht. Und das sind die Leitlinien, auf die sich unsere Hausärzte verlassen.
Positiv ist, dass wir in unserem Parlament eine parteiübergreifende Fraktion haben, die sich mit der Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Medikamenten befasst. Sie hat es geschafft, Public Health England, einen Zweig des National Health Service, dazu zu bewegen, die Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Medikamenten, einschließlich Antidepressiva, zu untersuchen. Das geschieht derzeit. NICE, unser National Institute of Clinical Excellence, das die NICE-Richtlinien vertritt, überarbeitet seine Richtlinien. Die Medien sind derzeit voll von Berichten über Menschen, die Schwierigkeiten haben, von Antidepressiva loszukommen, und wie überversorgt sie sind.
Wieder einmal haben wir es mit einem Berufsstand zu tun, der im Namen seiner Arbeitgeber (der Pharmakonzerne, um es ganz offen zu sagen) darauf beharrt, dass es kein Problem sei. Sie sollten mehr Menschen Antidepressiva verschreiben. Sie werden einfach abgehängt. Sie machen sich selbst für die Debatte nahezu irrelevant. Wir haben also den öffentlichen Kampf gewonnen, und wie ich bereits sagte, weiß die Öffentlichkeit bereits, was Depressionen verursacht. Die Öffentlichkeit glaubt nicht, dass es ein chemisches Ungleichgewicht ist. Das hat sie nie geglaubt.
Ich kämpfe seit wahrscheinlich 40 bis 50 Jahren für diese Situation, und es ist ein harter Kampf, denn ehrlich gesagt hat sich die Situation in dieser Zeit nur geringfügig verbessert. Wir werden jetzt zum Beispiel den Beginn des Niedergangs der Antidepressiva erleben. Die nächste Welle biologischer Behandlungen ist bereits in Vorbereitung. Natürlich versuchen wir auch, die Elektrokrampftherapie (EKT) loszuwerden – das wird vor dem Ende der Antidepressiva geschehen, das ist meine Prognose.
Aber es sind neue Medikamente in Planung. Das neueste wurde gerade zugelassen – dieses Ketamin-Nasenspray, um Himmels willen. Das ist unglaublich. Ketamin ist ein Halluzinogen und wurde als Beruhigungsmittel für Pferde eingesetzt. Es ist eine Straßendroge, und ich zweifle keine Sekunde daran, dass man sich eine halbe Stunde lang gut fühlt, wenn man Ketamin in die Nase nimmt, genauso gut, wie wenn man Kokain geschnupft hat. Aber als medizinische Behandlung für eine psychische Erkrankung ist es unfassbar.
Wir alle wissen, dass es eine Parallele zur Elektrokrampftherapie ist, wenn diese nachlässt. Es gibt bereits diese leichte Hirnstimulation. Ich habe dieses Bild aus dem Jahr 1984 vor Augen: Depressive Menschen können sich selbst stimulieren. Sie haben einen kleinen Knopf in der Tasche und jedes Mal, wenn sie sich schlecht fühlen, können sie den Knopf drücken und ihr Gehirn wird leicht stimuliert. Das macht mir wahnsinnige Angst.
Wenn Sie depressiv sind und es funktioniert, hilft es vielleicht manchen Menschen. Um auf Ihre ursprüngliche Frage zurückzukommen, warum dieses Modell so attraktiv ist: Es liegt daran, dass es eigentlich nicht schwer ist, Menschen künstlich ein besseres Gefühl zu geben. Die Hälfte von uns tut das jedes Wochenende mit der einen oder anderen Substanz. Sich künstlich vorübergehend besser zu fühlen, ist nicht schwer. Aber es dauerhaft zu tun, ohne das Gehirn zu schädigen, dafür haben wir noch keinen Weg gefunden.
AV: Eine weitere Frage bezog sich auf die Zeitschrift „Psychosis“, deren Herausgeber Sie sind. (Link unter Quelle) Möchten Sie kurz darüber sprechen, welche Art von Forschungsergebnissen Sie dort veröffentlichen möchten?JR: Ja, ich bin sehr stolz, Herausgeber der Zeitschrift „Psychosis“ zu sein, die gerade ihr zehnjähriges Bestehen feierte. Es handelt sich um die Zeitschrift der International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis, einer wunderbaren Organisation mit Niederlassungen in etwa 25 Ländern.
Es gab eindeutig eine Lücke auf dem Zeitschriftenmarkt (wenn ich diesen Begriff verwenden darf), da die meisten wissenschaftlichen Zeitschriften im Bereich Psychose entweder furchtbar biologisch oder überwiegend psychiatrisch ausgerichtet sind. American General Psychiatry, British General Psychiatry und alle anderen führenden Zeitschriften haben sich mit der Veröffentlichung psychosozialer Forschung zu Ursachen oder Lösungen sehr zurückgehalten. Es gab offensichtlich eine Lücke zu füllen.
Wir veröffentlichen eine ganze Reihe von Themen. Wir veröffentlichen traditionelle quantitative und epidemiologische Studien, aber auch gerne qualitative Studien, bei denen 10 bis 15 Personen zu einem interessanten Thema befragt wurden. Jede Ausgabe enthält außerdem mindestens einen Bericht aus erster Hand, meist von Menschen, die eine Psychose hatten und im psychiatrischen System behandelt wurden. Sie berichten, was die Ursachen für Psychosen in ihrem Leben sind und wie sie sich im psychiatrischen System behandelt fühlten – meist nicht sehr gut. Manchmal berichten auch Fachleute aus dem Bereich der psychischen Gesundheit, wie es ist, im psychiatrischen System zu arbeiten und so weiter.
Eine interessante Geschichte: Als wir anfingen, dachten manche Leute in unserer Gesellschaft, wir könnten finanziell nicht überleben, wenn wir nicht wie alle anderen Zeitschriften Werbung von Pharmaunternehmen schalten würden. Ich hatte gesagt, dass ich in diesem Fall nicht Herausgeber sein würde, also mussten wir das irgendwie regeln. Ich schrieb an den Verlag, Routledge, und fragte: „Was meinen Sie? Ist es rentabel, eine Zeitschrift für psychische Gesundheit ohne Werbung von Pharmaunternehmen herauszugeben?“ Sie antworteten mit einem schönen Brief: „Was ist nur mit Ihnen Leuten aus der Psychiatrie los? Wie glauben Sie, können Physik- und Geologiezeitschriften und alle anderen Wissenschaftszeitschriften der Welt ohne Geld von Pharmaunternehmen überleben? Natürlich brauchen Sie kein Geld von Pharmaunternehmen.“
Das war also die Lösung. Wir werden nie wieder Werbung von Pharmaunternehmen und/oder Autoren mit Interessenkonflikten sehen. Wir sind in dieser Hinsicht einzigartig, nicht ganz einzigartig, es gibt immer noch ein oder zwei, die das nicht tun, und das ist sehr wichtig. Hoffentlich ist es ein nützlicher Ort für Menschen, ihre Erfahrungen zu veröffentlichen, auch für angehende Forscher. Manchmal ist es schwierig, den ersten Artikel zu veröffentlichen.
AV: Wir haben viel besprochen. Vielen Dank, dass Sie sich so geöffnet und uns so viel von Ihren Einflüssen erzählt haben. Ich denke, es war für mich als angehende Psychologin sehr hilfreich, dieses persönliche Gespräch mit Ihnen zu führen.JR: Es hat mir Spaß gemacht. Okay, danke. Bis bald.
MIA-UMB News Team : Akansha Vaswani ist Therapeutin und Forscherin mit besonderem Interesse an den Lebenserfahrungen von Menschen. Ihr Studium der Ehe- und Familientherapie stärkte ihr Engagement für soziale Gerechtigkeit, dekolonialisierende, feministische und sozialkonstruktivistische Therapieansätze. Derzeit forscht sie zu Vorurteilen in der psychiatrischen Forschung, den psychosozialen Aspekten chronischer Erkrankungen und den Auswirkungen struktureller Gewalt auf marginalisierte Gemeinschaften.
.
Quelle:
https://www.madinamerica.com/<wbr />2019/05/an-interview-with-dr-<wbr />john-read/
.
Petition für einen Wandel im psychiatrischen Gesundheitswesen und in der Psychopharmakologie – an die WHO und weitere:
29/09/2025 um 11:54 Uhr #416769„Der gefährliche Umgang der CDU mit psychisch kranken Menschen“Würfelz, Shortvideo..
Petition für einen Wandel im psychiatrischen Gesundheitswesen und in der Psychopharmakologie – an die WHO und weitere:
29/09/2025 um 20:38 Uhr #416857Ich finde, die Schwelle zum Hausarzt zu gehen ist nicht so hoch, als sich an einen Therapeuten zu wenden, wenn man unter Depressionen leidet. Mein Hausarzt würde mir eher gut zureden, eine Therapie zu machen, als sie mir zu verweigern.
09/10/2025 um 12:12 Uhr #417562Liedermacher Konstantin Wecker unterstützt „Pforzheim nazifrei“
 :
:.
.
Petition für einen Wandel im psychiatrischen Gesundheitswesen und in der Psychopharmakologie – an die WHO und weitere:
-
AutorBeiträge
- Sie müssen angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.